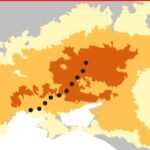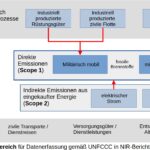Wie der Krieg in der Ukraine den Klimawandel befeuert
Die ökologisch verheerenden Wirkungen des Ukraine-Krieges wurden an dieser Stelle bereits wiederholt thematisiert. (Übersicht zu diesem Stichwort: Ukraine-Krieg). Siehe z.B. den eigenen Beitrag: Vom Krieg zum Ökozid in der Ukraine, woraus auch die beigefügte Grafik entnommen ist. (KP). Eine aktuelle … Weiterlesen →